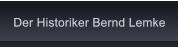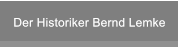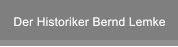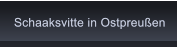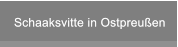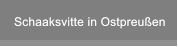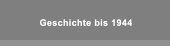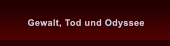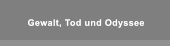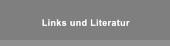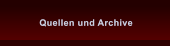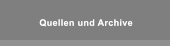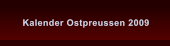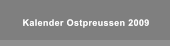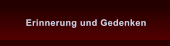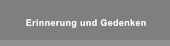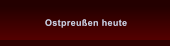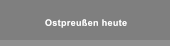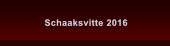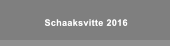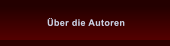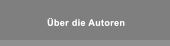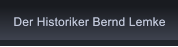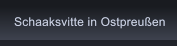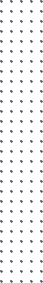
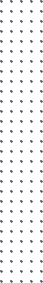
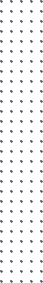
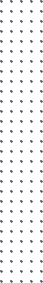
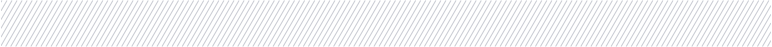



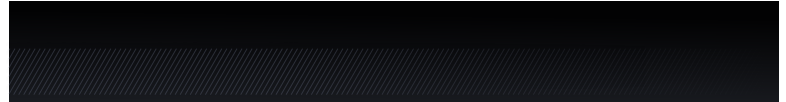
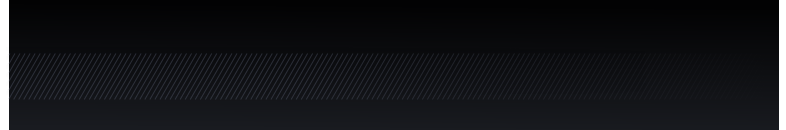
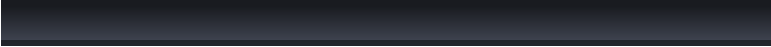
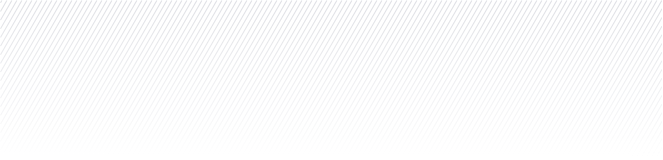





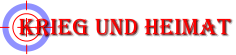


(Zur Anfangsseite auf Logo klicken)
Links und Literatur

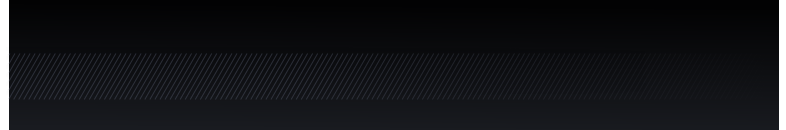
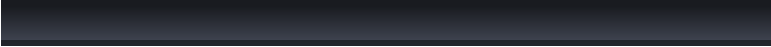
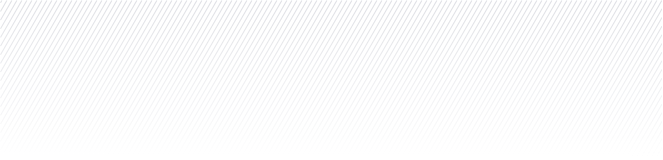





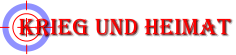


(Zur Anfangsseite auf Logo klicken)
Links und Literatur
Obwohl ich bereits vierzehn Jahre alt war, gab ich mein Alter
mit elf Jahren an; zumal ich ein schmächtiges Kerlchen war.
Jetzt befahlen sie mir, mit ihnen zu gehen. Ich versuchte,
mich dem zu widersetzen. Als ich mich wehrte, wurde ich
mit einem Holzknüppel derart hart geschlagen, bis ich willenlos
war. Für meine Mutter, meine Geschwister und mich brach
eine Welt zusammen. Nun zerrten sie mich in ein Haus, wo
ich durchsucht wurde. Als ich auf ein russisches Flugblatt
verwies, das ich bei mir hatte und auf dem geschrieben stand,
dass dieser Schein als Passagierschein bei der Gefangennahme
gelte, lachten die anwesenden Russen nur höhnisch. Später
brachten sie mich in einen Raum des Hauses, in dem sich bereits
mehrere gleichaltrige Jungen aufhielten. Einen der Jungen
erkannte ich als den Erich Borm aus Steinort.
Die folgende Nacht hatten meine Angehörigen in dem betreffenden
Ort verbracht. Es war die Hölle gewesen. Einer der russischen
Männer hatte versucht, meine Mutter zu vergewaltigen. Als sie
sich dem Vorhaben erfolgreich widersetzt hatte, war sie von
dem Peiniger mit dem Gewehrkolben derart am Kopf zugerichtet
worden, dass sie blutüberströmt zusammenbrach. In Schakaulack
hatten sie in der Hoffnung übernachtet, dass ich wieder zu ihnen
zurückkommen würde.
Im Lager waren etwa 36 Jungen in einem Raum untergebracht. Das vorhandene Fenster
war mit Brettern und Draht vernagelt. Links und rechts der Wände befanden sich
durchgezogene Holzpritschen, darauf schliefen wir. Zweimal am Tage – morgens und
abends – ließen uns die Bewacher, die mit Maschinenpistolen bewaffnet waren, aus dem
Raum, um hinter dem Haus, wo sich eine Grube befand, unsere Notdurft zu verrichten.
Ansonsten befand sich im Raum für die Notdurft eine 20-Liter-Milchkanne, die morgens
regelmäßig überlief. Es stank fürchterlich. Abends gab es ein Stück Brot, das auch für den
nächsten Morgen reichen musste. Mittags bekamen wir eine Kartoffelsuppe, die deutsche
Frauen gekocht hatten. Nachts, wenn wir schlafen wollten, holten uns die Bewacher zum
Verhör. U. a. wurden wir gefragt, ob wir Trinkwasser vergiftet, Brücken gesprengt und auf
russische Soldaten geschossen hätten. Wurden die Fragen wahrheitsgemäß verneint, gab
es so lange Schläge, bis wir die Fragen wahrheitswidrig mit „Ja“ beantworteten. Von Zeit zu
Zeit kam abends ein russischer Lastwagen amerikanischer Bauart vorgefahren. Darauf
wurden vier bis fünf Jungen verladen und abtransportiert. Ins Lager sind sie während
meines Aufenthaltes nicht zurückgekehrt. Auch befand sich in dem Lager ein ungefähr 35
Jahre alter Mann, der sich als Litauer ausgab und die russische Sprache beherrschte. Ich
hatte den Eindruck, dass er ein Spitzel der Russen war und uns aushorchen sollte. Er hatte
später ein Einzelzimmer. Trotz unseres Schicksals versuchte ich gemeinsam mit einem
anderen Jungen in den Worten der Bibel, die man ihm belassen hatte, Trost zu finden.
Ich war vielleicht schon zwei Wochen im Lager, als eines Tages unsere Bewacher tüchtig
dem Alkohol zugesprochen hatten und sich vergnügten. Nun glaubten wir, dass die Zeit für
eine Flucht günstig sei. Wir montierten den Stacheldraht und die Bretter vom
Fensterrahmen und gelangten ins Freie. Es mag morgens vier Uhr gewesen sein. Wir acht
Jungen waren noch nicht weit gelaufen, als uns zwei russische Soldaten, die mit
Fahrrädern daher kamen, aufgreifen und mitnehmen wollten. Um Mitleid zu erregen, aber
auch aus echter Angst, weinten wir herzzerreißend; schließlich ließen sie von uns ab.
Am Nachmittag dieses Tages kamen wir zur Stadtgrenze der Kreisstadt Labiau. Dort
wurden wir von einem russischen Posten, der am Schlagbaum in einem Kleiderschrank
Wache hielt, angehalten. Er befahl uns, neben seinem Kleiderschrank im Graben Platz zu
nehmen. Nun telefonierte er und später traf ein russischer Offizier mit einem weiteren
Soldaten ein. Der Offizier fragte uns in gebrochenem Deutsch, wohin wir wollten. Nachdem
wir ihm erklärt hatten, dass wir unsere Angehörigen suchen, schickte er den ersten
Soldaten fort. Nach etwa einer halben Stunde kehrte dieser zurück und gab jedem von uns
ein Brot. Scheinbar haben wir so elend ausgesehen, dass sie Erbarmen mit uns hatten. Der
Soldat, der die Brote gebracht hatte, befahl uns, mit ihm zu kommen. Er marschierte hinter
uns und wies uns jeweils den Weg durch Labiau. Dabei hatte er sein Gewehr schussbereit.
Wir waren der Annahme, wieder im „Knast“ zu landen. Nachdem wir die Deimebrücke
überquert hatten, ließ er uns wissen, dass wir abhauen sollten. Er hatte uns eine Chance
gegeben, die wir nutzten.
Am Großen Friedrichsgraben, einem Kanal parallel zum Haffufer, zogen wir in Richtung
Elchniederung. Als die Nacht hereinbrach, übernachteten wir in einem Haus, in dem auch
andere Deutsche waren. Auch in dieser Nacht holten sich die Peiniger wieder die
deutschen Frauen.
Am nächsten Morgen tippelten wir weiter am Kanal entlang nordwärts. An einem
Heuberg angekommen sahen wir Deutsche, die dabei waren, einen Pferdewagen mit
Heu zu beladen. Im Gespräch mit ihnen glaubte eine Frau mich zu erkennen und fragte
mich, ob ich der Herbert der Rosa Schütz (Mädchenname meiner Mutter) wäre. Diese
Frau war Lotte Newiger, die aus Schaaksvitte stammte und nach Arnau geheiratet hatte.
Diese Deutschen waren von den Russen angewiesen worden, die im Dorf
zusammengetriebenen Kühe zu versorgen und zu melken. Dieses Dorf hieß Agilla
(Haffwerder) und hatte noch eine funktionierende Molkerei. Wir erzählten ihnen, wie es
uns ergangen war. Als sie den Wagen mit Heu beladen hatten, meinten sie, wir sollten
mit ihnen gehen, sie würden uns etwas zu essen geben. Wir acht Jungen teilten uns auf
und blieben eine Nacht bei drei verschiedenen Familien. Einer der Jungen und ich
waren bei der erwähnten Lotte Newiger untergebracht. Sie hatte erkannt, dass ich stark
verlaust war. Sie bat mich, mich meiner Kleider zu entledigen und verbrannte sie.
Zwischenzeitlich hatte sie einen Kessel mit Wasser heiß gemacht. Als sie sah, dass
meine Haut von den Läusen zerfressen war, gab sie dem kochenden Wasser
Tabakstengel hinzu. Diese Tabakstengel sollten desinfizierend wirken. Außerdem hatte
sie mir andere Kleidung besorgt, die sie irgendwo in den leerstehenden Häusern
gefundenen hatte. Persönliches Eigentum gab es durch die herrschenden Bedingungen
nicht mehr. Wenn man etwas fand, gehörte es einem. An dem darauf folgenden Tag
mussten wir allerdings wieder fluchtartig den Ort verlassen, weil sich die Russen für uns
„interessierten“. Wir waren ja als Fremde angekommen. Wir acht Jungen machten uns
auf den Weg weiter in Richtung Norden. Nach etlichen Kilometern bogen wir nach rechts
in die Waldungen ab. Stundenlang durchzogen wir einen großen und schier endlosen
Wald, bis wir zu einem verlassenen Haus kamen. Als wir das Haus betraten, stellten wir
fest, dass eine ganze Familie von den Russen erschossen worden war. Von der Angst
gepackt, verließen wir diesen Ort des Grauens und zogen weiter durch den Wald.
Übernachtet haben wir angesichts der nicht mehr winterlichen Temperaturen
überwiegend im Wald.
Eines Tages kamen wir auf eine feldwegähnliche Straße und sahen ein allein stehendes
Haus. Es schien ein Forsthaus gewesen zu sein, in dem sich jetzt Deutsche aufhielten.
Auch hierhin kamen nachts wieder die russischen Vergewaltiger und holten sich ihre
weiblichen Opfer.
Nachdem wir schon eine geraume Zeit umher geirrt waren, bemühten wir uns, irgendwo
sesshaft zu werden. Eine Sesshaftigkeit bedeutete aber auch russische Kontrolle. Zumal
unsere Befürchtungen immer noch berechtigt waren, dass wir nach Sibirien gebracht
werden könnten.
Wir zogen am folgenden Tag in Richtung Kurisches Haff und kamen schließlich wieder
zum Großen Friedrichsgraben. Mit einem Kahn überquerten wir den Kanal und
befanden uns nunmehr auf der Haffseite des Kanals. Bei Agilla, zwischen dem Großen
Friedrichsgraben und dem Kurischen Haff, stand ein Backsteingebäude für zwei
Familien. In der einen Hälfte hatte sich bereits eine deutsche Familie einquartiert. Die
andere Haushälfte „mieteten“ wir Jungen. Die Kartoffelmieten waren noch reichlich
gefüllt, somit konnten wir nicht verhungern. Da die Pumpstationen außer Betrieb waren,
war die Niederung teilweise überschwemmt.
Jetzt kam mir meine bis dahin kindliche Wissbegierde bezüglich des Backens und
Kochens zugute. Obwohl ich eigentlich der Jüngste von uns war, habe ich versucht, für
uns Essen zu kochen und auch Brot zu backen. Die anderen Jungen hingegen
durchstöberten die weiter entfernten Häuser nach Getreide und sonstigen Dingen, die
noch genießbar waren. Das Haus stand direkt hinter dem Deich und davor war das
Kurische Haff. Wir hatten beobachtet, dass die russischen Soldaten oft mit einem Kahn
und mit Handgranaten bewaffnet zum „Fischfang“ aufs Haff hinausfuhren. Nachdem sie
mit ihrer Beute weg waren, gingen wir bei günstigen Wind- und Wellenverhältnissen zum
Ufer des Haffes und suchten nach angeschwemmten Fischen, die ich dann gekocht
habe.
Eines Tages fand ich unter Kohlen versteckt eine Morsetaste. Ich glaubte und hoffte,
unter dem Kohlenhaufen oder anderen Verstecken eine komplette Ausrüstung wie
Sender und Empfänger und einen Dynamo zu finden. Ich war deshalb so versessen
darauf, weil ich das Morsefunken bereits erlernt hatte. Meine Hoffnungen wurden leider
enttäuscht. Inzwischen auch hier wieder von den Russen aufgespürt, beschlossen wir,
anstatt nach Osten nunmehr gen Westen in Richtung unserer Heimatorte zu ziehen.
Zuvor wurde auf einer Kaffeemühle Roggen geschrotet und ich hatte begonnen, für uns
Brot zu backen. Zwei Tage später machten wir uns auf den Weg entlang des Kurischen
Haffes in Richtung Labiau/Deimemündung. Im Schilf entdeckten wir einen Kahn. Da das
Wasser nicht sehr tief war, ging Erich Borm zu diesem Boot, um zu schauen, ob auch
Paddel darin waren.
Es befanden sich tatsächlich zwei Paddel darin und wir acht Jungen „enterten“ das Boot,
während zwei Jungen ruderten, hatten sich die sechs anderen auf dem Boden hingelegt,
um nicht Aufsehen zu erregen. Am späten Nachmittag überquerten wir die
Deimemündung und gingen im Fischerdorf Labagienen an Land.
Im Haus eines Fischers, den die Russen nicht vertrieben hatten, baten wir um Aufnahme
für eine Nacht. Er verwies uns auf den Heuboden. Gegen Abend brachte uns seine Frau
einen halben Eimer Milchsuppe (Klunkermus). Diesen Fischer hatte ich gefragt, ob sich
hier im Dorf Leute aus meinem Heimatort Schaaksvitte aufhalten würden. Er verneinte
meine Frage. Am nächsten Tag wollten wir mit „unserem“ Boot weiter fahren. Da wir aber
kein Segel und auch kein Ruder hatten, mussten wir diese Gegenstände „organisieren“.
In der Finsternis machten wir beide, Erich Borm und ich, uns auf die Suche. Erich war ein
Fischersohn und verstand etwas davon. Wir hatten Glück und fanden auf einem Zaun ein
Segel, das offensichtlich zum Trocknen dort abgelegt worden war. Wir brachten das
Segel zu unserem Boot. Am anderen Morgen, noch bevor die Fischer ihre am Vortag
gestellten Netze einholten, machten Erich Borm und ich das Boot klar; auch ein Ruder
hatten wir „organisiert“. Nach und nach liefen die Jungen zum Boot und legten sich flach
auf den Boden. Nur Erich Borm und ich taten so, als würden wir zum Fischfang
hinausfahren und zogen das Segel auf. Wir fuhren bei relativ guten Windverhältnissen
los. Eine größere Strecke hatten wir schon hinter uns, als sich die eigentlichen Fischer
auf den Weg zu den Fischgründen aufmachten.
Als wir die Landzunge bei Rinderort umsegelt hatten, trafen wir auf dem Haff Fischer an,
die für ein anderes russisches Fischkommando fischten. In einem der Fischerboote
erkannte ich zwei Personen, die aus meinem Heimatort Schaaksvitte stammten. Ich
fragte, ob sich eventuell auch Angehörige meiner Familie in dem Ort aufhalten würden, in
dem sie nun wohnten. Mir wurde geantwortet, dass mein Großvater mit einer seiner
Töchter und deren Kindern in diesem Fischerdorf wohnen würden. Nun konnte mich
nichts mehr halten und wir legten mit unserem Boot in Julienhöh an. Wir Jungen
verabschiedeten uns voneinander und jeder ging seinen Weg. Einen dieser Jungen traf
ich zwei Jahre später in Königsberg, als ich in den Trümmern der Stadt nach Ersatzteilen
für eine Nähmaschine suchte. Die Familiennamen der Jungen sind mir leider nicht
bekannt, da wir uns nur mit dem Vornamen angeredet haben.
Ich ging zu dem Haus, in dem mein Großvater und meine Tante wohnen sollten. Dort traf
ich Tante Hannchen mit ihren Kindern an, die in Uggehnen gewohnt hatten. Außerdem
hielten sich in dem Haus noch andere Verwandte auf. Nach einer kurzen Begrüßung mit
den Verwandten machte ich mich auf den Weg zum Hafen. Mein Opa war vom Fischfang
zurückgekehrt und legte mit einem anderen Fischer die Netze für die nächste Ausfahrt
bereit. Er war erschrocken, als er mich sah. Er wollte natürlich wissen, wo die anderen
Familienmitglieder seien. Nachdem ich ihm erzählt hatte, wie es uns und mir persönlich
ergangen sei, erzählte er mir, dass er gehört hätte, dass meine Mutter und meine
Geschwister sowie die Familie Voß in dem Fischerdorf Labagienen sein würden, wo ich
die letzte Nacht verbracht hatte. Nunmehr beabsichtigte ich, auf dem Landweg dorthin zu
gehen. Dies ließ mein Großvater, der Gefahr witterte, jedoch nicht zu. Er befürchtete,
dass mich die Russen erneut aufgreifen und verschleppen würden. Stattdessen nahm er
mich zum Fischfang mit. Ansonsten schlief ich in der Küche des Hauses auf einem
Steinfußboden, da das kleine Siedlungshaus voller Menschen war.
In gewissen Abständen kam die Ehefrau unseres Hauptlehrers Schmissat, die wie noch
andere Schaaksvitter am Dorfende von Julienhöh untergebracht und den Russen auch
nicht entkommen war, zu meinem Großvater, um sich Fische zu holen. Sie schien sehr
verzweifelt. Auch ihr hatten die Russen alles abgenommen. Meinem Großvater hatte sie
offenbart, sich das Leben nehmen zu wollen, weil ihr alles aussichtslos erschien. Alles
Zureden meines Großvaters hatte nichts genutzt. Eines Tages war sie ins Wasser des
Kurischen Haffes gegangen und hatte sich ertränkt.
Mit der Anna Rohr, ebenfalls aus Schaaksvitte, ruderte ich mit einem Boot zu der Stelle,
wo wir sie im Wasser vermuteten. Wir fanden sie an einer Stelle, an der das Wasser nur
eine Tiefe von etwa 50 cm hatte. Mir schien es unerklärlich, wie sich jemand bei einer
solch niedrigen Wassertiefe ertränken kann. Einige Meter von der bestreffenden Stelle
sah ich einen größeren Stein im Wasser – Frau Schmissat muss wohl über diesen Stein
gestolpert und hingefallen sein und konnte sich anscheinend nicht mehr aufrichten. An
einem Strick befestigten wir ihren Leichnam und nahmen sie mit unserem Kahn in
Schlepp. Im Hafen angekommen, kamen andere Leutchen hinzu und wir halfen ihren
Leichnam zu bergen. Wir wickelten sie in Decken und gruben im Garten des Hauses, in
dem wir wohnten, ein Loch und bestatteten sie.
Wie schon erwähnt, lebten außer Frau Schmissat noch andere Familien aus
Schaaksvitte am Dorfende von Julienhöh. U. a. waren auch Frau Tischler-Lemke mit
ihren vier Kindern sowie deren Schwägerin Grete Lemke dort untergekommen. Frau
Lemke, die bei der Flucht hochschwanger und am 24. Januar 1945 mit ihren Kindern
von Schaaksvitte nach Garbseiden zu ihren Verwandten geflohen war, hatte dort beim
Einmarsch der Russen einen Sohn geboren, der die Strapazen nicht überstand und
starb und nicht beerdigt werden konnte. Die Bevölkerung wurde aus dem Kampfgebiet
ostwärts getrieben. Durch die Entbindung geschwächt, erkrankte auch Frau Lemke.
Zwei ihrer Kinder und ich fuhren sie mit einem Handwagen von Julienhöh nach
Kampken zu einem russischen Militärarzt, der sie ärztlich untersuchte und auch
Medikamente gab. Im Sommer 1945 starb sie an den Folgen der unter mangelnder
Hygiene stattgefundenen Entbindung. Sie wurde von ihren Kindern in einem Vorgarten
des Fleischers Penk in Postnicken beerdigt.
Inzwischen war der Krieg zu Ende und auch die Vergewaltigungen wurden weniger. Die
unterschiedlichen Ängste während des Tages und besonders in der Nacht nahmen aber
auch dadurch ab, weil sich hier ein russisches Fischkommando gebildet hatte und wir
damit einen gewissen Schutz genossen.
Eines Tages wurde das Fischkommando von Julienhöh nach Steinort verlegt, etwa vier
Kilometer von unserem Heimatort Schaaksvitte entfernt. Der Wunsch unserer Fischer
war es immer gewesen, näher zum Heimatort zu kommen. Noch immer hatten wir die
Hoffnung, dass sich alles normalisieren würde.
Inzwischen war auch der Sommer eingekehrt. Fast täglich ging ich von Steinort nach
Schaaksvitte, um den „Acker“ in unserem Garten zu bestellen. Ich grub den Garten um,
pflanzte Kartoffeln und Bohnen. Im Herbst ging unser Wunsch endlich in Erfüllung und
das Fischkommando wurde nach Schaaksvitte verlegt. Wir waren wieder Zuhause.
Wenn wir auch nicht in unseren eigenen Häusern wohnen durften, so doch wenigstens
im Dorf in der Nähe des Hafens.
Eines Tages trafen endlich auch meine Mutter mit meinen Geschwistern, meiner
Cousine Anja und der Familie Wilhelm Voß, mit der meine Mutter die ganze Zeit in
Labagienen zusammen gewesen war, mit einem Kahn in Schaaksvitte ein. Sie hatten es
gewagt, in der Nacht mit dem Kahn von Labagienen unbemerkt zu flüchten. Da jeder
versucht hatte, wieder in seinen Heimatort zu gelangen, fand sich die Familie
glücklicherweise wieder zusammen.
Halbwegs „normalisierte“ sich die Lage auch wieder für die Deutschen. Wir hatten
wieder die hygienischen Möglichkeiten, uns um unsere Sauberkeit zu kümmern, um der
„Haustiere“ Herr zu werden. Die Freude war groß, als einige Tage später auch die
Schwester meiner Mutter, Gertrud, mit ihren anderen drei Kindern eintraf. Auch ihre
einjährige Tochter hatte die Entbehrungen wie durch ein Wunder überstanden.
Nun waren wir natürlich bemüht, die vor unserer Flucht vergrabenen Schmalztöpfe und
Weckgläser auszugraben. Den Holz- und Wagenschuppen hatten die Russen in der
Zwischenzeit abgerissen. Man konnte nur vermuten, wo die beiden Vergrabungsstellen
waren. Hinzu kam, dass wir eigentlich nicht zur anderen Dorfseite durften. Unauffällig
hatte ich mit einer Metallsonde am Tage schon einmal eine Vergrabungsstelle
ausmachen können. In 20 cm Tiefe war ich auf Holz gestoßen. Da ich wusste, wie groß
die Holzkiste war, machte ich im näheren Umkreis mehrere Einstiche und war mir
sicher, die richtige Stelle gefunden zu haben. Die zweite Vergrabungsstelle mit dem
Rauchfleisch konnte ich nicht finden. Es kann allerdings auch sein, dass die Russen
beim Abriss des Schuppens die Stelle gefunden hatten. Meine Tante Trude und ich
beschlossen, unsere Vorräte in der darauf folgenden Nacht auf dem Dachboden meines
Großvaters, auf dem noch Heu gelagert war, zu verstecken. Um Mitternacht, als auch
die Russen zu schlafen schienen, machten wir uns in kriechender Haltung auf, um an
der von mir zuvor markierten Stelle mit einer kleinen Schaufel nach dem „Schatz“ zu
graben. Es ging alles sehr schnell und wir verstauten unsere „Beute“ in einem
Wäschekorb auf dem Heuboden.
Die Kiste haben wir wieder verschlossen und Erde darüber geschaufelt. Im Laufe des
nächsten Tages schafften wir Kinder die einst vergrabenen Lebensmittel nach und nach
zur anderen Dorfseite, wo wir wohnten.
Insgesamt gesehen, war die Versorgung der deutschen Menschen noch gesichert, da in
den Scheunen die im Herbst eingefahrene Ernte lagerte. Die Getreidekörner wurden aus
den Ähren mit einem Knüppel geklopft und dann mit einer Kaffeemühle oder einer
kleinen Handmühle zu Schrot gemahlen. Andererseits lieferte uns das Haff die
entsprechende Fischversorgung. Die von mir angepflanzten Kartoffeln hatten leider
überwiegend die Russen „geerntet“.
Im Frühjahr 1946 wollten meine Tante und ich landeinwärts Fische gegen
Getreideschrot und Kartoffeln tauschen. Für derartige Tauschgeschäfte hatte meine
Tante bessere Erfahrungen als meine Mutter. Mit einem Handwagen machten wir uns
auf den Weg und fuhren von Dorf zu Dorf, wo noch Deutsche waren. Das Geschäft lief
relativ gut und wir waren auch mit dem Ertrag zufrieden. Auf dem Heimweg verfolgten
uns zwei russische Soldaten. Als wir sie bemerkten, beschleunigten wir unsere Schritte.
Aber auch sie wurden im Schritttempo schneller. In der Nähe eines kleinen Wäldchens
hatten sie uns eingeholt. Sie zerrten meine Tante und mich samt Handwagen die
Straßenböschung hinunter, wobei der Wagen umkippte und die Ladung verstreut heraus
fiel. Unweit von mir entfernt schändeten sie meine Tante. Ich konnte zu der Zeit schon
einige Worte russisch. In meiner kindlichen Naivität machte ich einen verhängnisvollen
Fehler, der mich beinahe das Leben gekostet hätte. Ich sagte dem einen Peiniger, dass
ich wüsste, woher sie kämen und wo sie stationiert seien. Daraufhin zog er seine Pistole
und wollte mich erschießen. Als ich ihn in meiner Todesangst anflehte, wurden
scheinbar doch noch menschliche Gefühle bei ihm wach und er ließ von mir ab.
Oft gingen mein Bruder und ich zu den im Dorf wohnenden Russen und boten unsere
Arbeitskraft als Holzhacker an. Mit einem Karren holten wir aus den Scheunen und
Stallungen Balken und Bretter, die wir zu Brennholz sägten und hackten. Dafür gab es
schon mal ein Essen oder ein Stück Brot, aber auch Tabak, den mein Großvater als
starker Raucher sehr schätzte. Um über einen längeren Zeitraum „qualmen“ zu können,
vermischte er den Tabak oft mit getrockneten Kirsch- oder Lindenblättern.
Am Palmsonntag 1945 hätte ich in der Kirche in Schaaken konfirmiert werden sollen.
Konfirmation war immer ein besonderes christliches Ereignis gewesen. Bedingt durch die
von mir zuvor erwähnten Ereignisse, war dies jedoch nicht mehr möglich gewesen. Unser
Pfarrer Glaubitt, der den Russen auch nicht entkommen war, war vom russischen
Geheimdienst NKWD wiederholt nach Carmitten in die Kellerräume im Gutshaus Sehmer
zum Verhör geholt und gefoltert worden.
Als der NKWD ihn wieder frei gelassen hatte, haben ihn einige Kinder gebeten, uns
notdürftig die Konfirmation (Einsegnung) zu ermöglichen, was er auch im Frühjahr 1946
getan hat. Alles musste heimlich geschehen und an eine ansonsten übliche Feierlichkeit,
war wegen der Umstände nicht zu denken.
Im August 1946 mussten die Deutschen auch Schaaksvitte wieder verlassen, weil nunmehr
Zivilrussen angesiedelt wurden. Die Fischer wurden einen Kilometer landeinwärts in
Eythienen angesiedelt, während unsere Familie zur Domäne Schaaken pilgerte. In
Schaaken quartierten wir uns in einem leerstehenden Insthaus der Domäne ein. Die Fenster
wurden mit Brettern vernagelt und mit umher liegenden Fensterscheiben versehen. Möbel
und Bettgestelle im herkömmlichen Sinne hatten wir auch nicht mehr. Wir schliefen auf
Matratzen auf dem Fußboden. Während die in Eythienen wohnenden Fischer weiterhin für
die Russen fischten, mussten wir auf der Sowchose Feldarbeit verrichten. Meine beiden
Geschwister waren noch zu jung, um eine solche Tätigkeit verrichten zu können. Wohin
man auch zur Arbeit eingeteilt wurde, zuerst schaute man, ob es nichts „Organisierbares“ –
sprich Essbares – gab. Jeweils nach einer Arbeitswoche gab es ein Stück Brot, einige Löffel
Zucker und ein paar Löffel Graupen. Die nicht arbeitsfähigen Menschen erhielten keinerlei
„Produkte“; der russische Name für Lebensmittel.
Dann brach der verhängnisvolle harte Winter 1946/47 für die schon geschwächten
Deutschen an. Wegen der eisernen Kälte konnte keine Feldarbeit verrichtet werden und
somit gab es auch keine „Produkte“. Unser Nachbar Dehn, der von Beruf Melker war und
die Kühe der Sowchose zu versorgen hatte, wollte mir Gutes tun und vermittelte mir eine
Arbeitsstelle in der Viehversorgung. Als abgemagertes kleines Kerlchen musste ich ca. 30
Kühe versorgen und ausmisten. Angesichts der ausgezehrten Kräfte, schaffte ich es selten,
den vollen Mistkarren zum Misthaufen zu fahren. Oft kippte der volle Karren um und ich
hatte die doppelte Arbeit. Nach einer Woche erkrankte ich sehr und konnte dadurch keiner
Arbeit mehr nachgehen.
Überall herrschte eine erbarmungslose Hungersnot und hinzu kam die fürchterliche Kälte
bis zu 38 Grad minus. Es brachen Seuchen aus, Hunger und verschmutztes Wasser lösten
eine Typhusepidemie aus. Bis zum Skelett abgemagerte Menschen, deren Beine vom
eingelagerten Wasser angeschwollen waren, konnten sich kaum noch bewegen.
Jetzt ging es ans „Eingemachte“. Es waren Rübenblätter, die die Deutschen im Herbst 1944
als Viehfutter im Silo eingelagert hatten. Nach über zweijähriger Lagerung haben wir dieses
Viehfutter gegessen. In dieser Not suchten wir auch nach Baumknospen, die geröstet,
gemahlen und zu einem Schleim gekocht wurden. Damals wurde ich wieder an die Aussage
des älteren russischen Soldaten erinnert, der gesagt hatte, wir würden noch mal Holz
fressen.
Als ich wieder einmal auf der Suche nach irgendetwas Essbarem war, fand ich auf einem
Schweinermisthaufen neben einem Schweinestall der Domäne Futterreste. Diese
Futterreste waren aus den Trögen der Schweine vor der neuen Fütterung entfernt worden.
Das, was man den Schweinen nicht mehr zugemutet hat, habe ich mitgenommen und mit
meiner Mutter und den Geschwistern gegessen.
Die Sterblichkeit war unterdessen groß. Ganze Familien wurden innerhalb von ein bis zwei
Tagen ausgelöscht. Hin und wieder kam zu uns der Nachbarsjunge Herbert Stellmacher
und klebte die auf einem Misthaufen des russischen Brigadiers gefundenen Kartoffelschalen
an die Ofentür, um etwas in den Magen zu bekommen. Nun kam auch er nicht mehr. Mit
seiner Mutter und seinen zwei Geschwistern war auch er verhungert.
Die Toten zu beerdigen, war durch die Entkräftung der noch Lebenden und die strenge
Kälte nicht möglich. Die Leichen brachte man in die inzwischen leer stehende Kirche und
verscharrte sie im Frühjahr in einem Massengrab. Damals war mir aufgefallen, dass das
weibliche Geschlecht anscheinend widerstandsfähiger ist, weil die Frauen und Mädchen
unter gleichen Bedingungen ein bis zwei Tage länger lebten.
Der Tod war für unsere Familie auch nur noch eine Frage der Zeit. Inzwischen kraftlos
geworden, konnten wir kein Brennholz mehr besorgen. Schließlich ging ich auf den
Dachboden und schnitt einen Balken heraus, der meiner Meinung nach keine tragende
Funktion hatte. Dieses Haus habe ich bei meinen Heimatreisen in den 90er Jahren
nochmals aufgesucht.
In Steinort war eine Cousine meiner Mutter mit ihrem Mann untergekommen. Bis zum
Wintereinbruch hatten sie dort für ein russisches Kommando gefischt. Da uns niemand
etwas Essbares geben konnte, auch unsere anderen Verwandten nicht, machte ich mich auf
den Weg dorthin in der Hoffnung, bei den dieser Cousine einige eingesalzene Fische zu
bekommen. Wäre ich unterwegs vor Entkräftung umgefallen und krepiert, hätte kaum
jemand nach mir gefragt, außer meiner Mutter vielleicht, die aber selbst schon mehr tot als
lebendig war. Es scheint heute kaum vorstellbar, dass fast jeder nur noch an sich dachte. In
solchen existentiell bedrohlichen Situationen kommt der persönliche Egoismus vollends
durch.
Bei meinen Verwandten jedoch bekam ich etwas zu essen und blieb dort eine Nacht. Ich
hatte einige Fische und Fischreste (Köpfe) mit bekommen und machte mich auf den
Rückweg zur Domäne Schaaken. Ich glaube sagen zu können, dass diese Verwandten
unsere Rettung in letzter Not gewesen sind.
Auf dem Weg zurück nach Schaaken sah ich, dass sich an einer Stelle viele Krähen
aufhielten. Ich hielt darauf zu und stellte fest, dass sie sich über einen toten Hasen
hermachten, der offensichtlich ebenfalls vor Entkräftung gestorben war. Dieser Hase kam
auch mir gerade recht und ich steckte ihn in meinen Rucksack.
Nach einigen Tagen machte ich mich auf den Weg zu meinem Großvater nach Eythienen.
Dort angekommen teilte man mir mit, dass die beiden Söhne von Tante Hannchen
verhungert waren. Ich ging zu dem Haus und sah die beiden ausgemergelten Skelette in der
Küche liegen. Später habe ich gehört, dass meine Tante gemeinsam mit ihrem Vater die
toten Kinder in einem Bombentrichter notdürftig mit Erde zugedeckt hat, weil auch sie nicht
mehr die Kraft hatten, ein tieferes Grab auszuheben. Etwas anderes war angesichts der
winterlichen Verhältnisse und der persönlichen Entkräftung nicht mehr möglich. An unseren
heutigen Vorstellungen und Verhältnissen gemessen erscheint dies unvorstellbar. Vor allem
für jene unvorstellbar, denen ein solches Schicksal erspart geblieben ist. Aber dies war die
grausame, unfassbare Realität. Wo war Gott, auf den wir vertraut haben? Warum hat er es
zugelassen, dass die vielen unschuldigen Menschen verhungerten? Für uns waren weder
Gott noch eine Gerechtigkeit existent. Ja, ich habe damals meine Geburt verflucht.
Es sah so aus, als wollten die Russen sich der Deutschen dadurch entledigen, indem sie sie
einfach dem Schicksal überließen. Im Winter 1946/47 tauchten erstmalig Gerüchte auf, dass
in Königsberg Kannibalismus aufgetreten sei.
Im Frühjahr 1947 gab es wieder Hoffnung und erste Überlebungschancen, als der Schnee
taute und sich die ersten Brennnesseln zeigten, die mit Viehsalz gekocht wie Spinat
schmeckten.
Ich war noch im Besitz eines Fischernetzes, das ich mir seinerzeit aus Schaaksvitte
mitgenommen hatte. Als das Eis im Haff geschmolzen war, gingen mein Bruder und ich zum
Haffufer und legten dort das Netz im Rohr und Schilf aus. Anfangs waren unsere Erträge
nicht besonders beträchtlich. Während der Laichzeit der Fische waren die Fangerträge aber
schon größer. Allmählich kamen auch unsere Kräfte wieder und schöpften neue Hoffnung.
Ich ging dazu über, die überzähligen Fische zu räuchern und sie in dem 30 Kilometer
entfernten Königsberg auf dem Basar zu verkaufen. Von dem Erlös kaufte ich dann etwas
Speck oder Butter und Streichhölzer. Für den 30 Kilometer weiten Fußweg brauchte ich
etwa fünf Stunden. Unterwegs habe ich oft Heidenängste ausgestanden. Meine Mutter wird
wohl oft um mich gebangt haben. Scheinbar hatte ich immer einen Schutzengel – und
vielleicht doch Gott in der Nähe? – gehabt!
Die Feldarbeit auf der Sowchose hatte auch wieder angefangen. Ich hatte mich
entschieden, dem Fischfang nachzugehen, da dies mir lukrativer als die Feldarbeit erschien.
Eines Tages – mein Bruder und ich waren mit unserem Fischfang auf dem Heimweg –
begegneten wir dem russischen Brigadier. Er frage mich, warum ich nicht zur Arbeit
kommen würde. Meine Antwort missfiel ihm wohl und er versetzte mir einen Fußtritt. Eine
geraume Zeit später hatte die russische Miliz erfahren, dass dieser Brigadier der Wlassow-
Armee – dies waren russische Freiwillige, die gegen die Rote Armee gekämpft hatten –
angehört hatte. Er wurde zu 25 Jahre Arbeitslager verbannt. Dennoch habe ich
zwischenzeitlich auf der Kolchose, insbesondere auf dem Felde, gearbeitet.